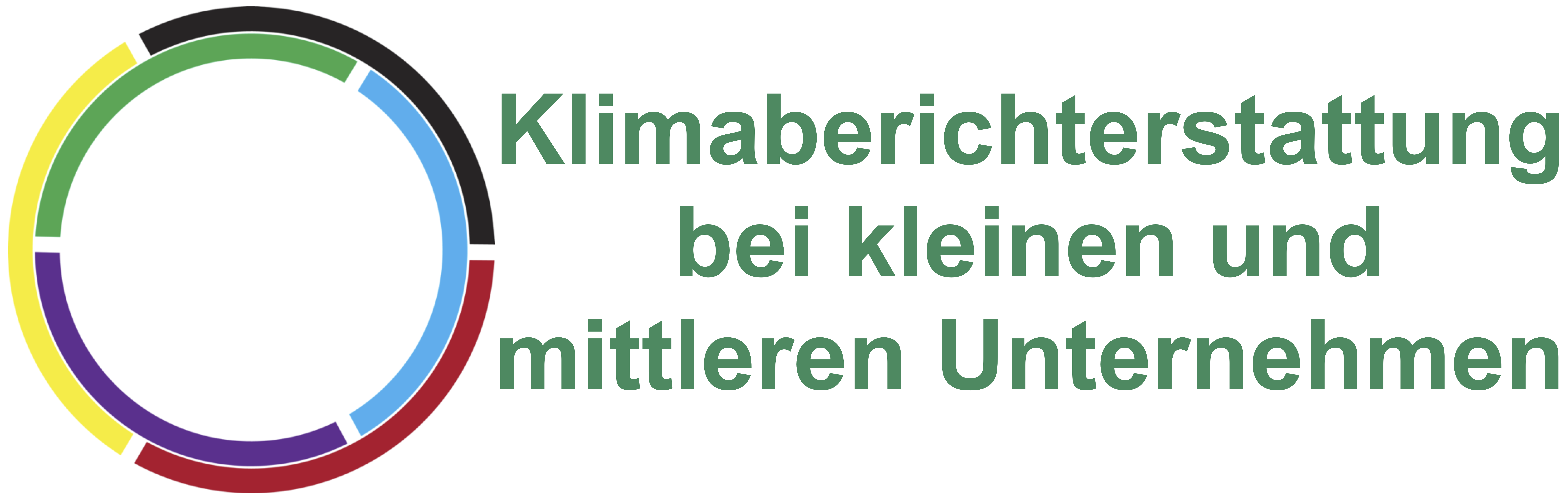Startschuss für den Projektverbund
30 Monate Arbeit, ein Budget von circa 590.000 Euro, 3 Organisationen und insgesamt 10 involvierte Mitarbeiter: Viel Kapazität, um an den Projektergebnissen zu arbeiten. Einiges soll erreicht werden bis zum Ende des Projektes.

Bilanzierung Kompetenzaufbau
Das BF/M-Bayreuth übernimmt federführend die Untersuchung der Qualität und Aussagekraft existierender Standardisierungsformate, regulatorische Anforderungen sowie den aktuellen Stand von Klima- und Nachhaltigkeitsberichten in der Praxis. Zum Abschluss des Projektes zeichnet das BF/M-Bayreuth Verantwortung für die Konzeptionierung und Implementierung eines einheitlichen und transparenten Rahmenwerkes, das insbesondere die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen in den Fokus rückt.
Im Laufe der Projektarbeit koordiniert das BF/M-Bayreuth darüber hinaus die Etablierung eines Netzwerkkreises, welcher einen Austausch und Kompetenzaufbau mit regionalen Unternehmen, Kommunen und Wirtschaftsförderungen fördern und verstetigen soll. Mehr dazu in der Zukunft!
Bedeutung für die Finanzwirtschaft
Der Lehrstuhl BWL I: Finanzwirtschaft und Bankbetriebswirtschaft der Universität Bayreuth ist im Projekt federführend verantwortlich für die finanzwirtschaftlichen, bankspezifischen und rechtlichen Forschungs- und Projektschwerpunkte. Im Rahmen von Kosten-Nutzen- und Kosten-Wirksamkeits-Analysen werden Klima- und Nachhaltigkeitsberichte als Instrument und Maßnahme für KMU anhand von quantitativen und qualitativen Kriterien und Berechnungsmodellen bewertet. Zudem wird die Relevanz von Nachhaltigkeitsaspekten und die Rolle von Klimaberichten in der Kreditvergabe gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Finanzpraxis analysiert.
Der LS BWL I (UBT) verfolgt im Rahmen des Projektvorhabens das Ziel, die Forderung nach mehr Transparenz nachhaltiger Aktivitäten und den Beitrag nachhaltiger Finanzprodukte und Finanzierungsmöglichkeiten für die Real- und Finanzwirtschaft von KMU und Mittelstand zu erforschen und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen in den Transformationsprozessen sowohl für die Realwirtschaft als auch den öffentlichen Sektor zu ermitteln. Zudem möchte der LS BWL I (UBT) einen Dialog zwischen Wissenschaft, politischen Entscheidungsorganen, Unternehmen und Finanzinstituten führen und die Relevanz von Klimarisiken und der Sustainable Finance für KMU und Mittelstand diskutieren.
Messmodell und Ökobilanzierung
Das bifa Umweltinstitut an der Universität Augsburg widmet sich im Rahmen der projektarbeit der Erstellung einer Ökobilanz anhand eines Modellunternehmens und untersucht, ob diese als Informations- und Entscheidungsinstrument zur Darstellung und Ableitung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Klima- und Nachhaltigkeitsberichterstattung geeignet ist. Zudem ist bifa im Verbundprojekt die Schnittstelle zwischen Betriebs- und Finanzwirtschaft und der Ökologie und Technik und übernimmt die qualitativen und quantitativen Datenerhebungen und -auswertungen über alle Arbeitspakete hinweg.
Ziel von bifa ist es, mithilfe der Projektergebnisse das Know-how im Bereich Life Cycle Assessment als Instrument für nachhaltiges und damit ressourcenschonendes, energie- und materialsparendes Wirtschaften und Produzieren zu stärken. bifa möchte durch die Erweiterung der Datenbasis den wissenschaftlichen Kenntnistand in der Unternehmenspraxis vertiefen und Hilfestellungen für KMU geben, Instrumente und Methoden effektiv, effizient und bestmöglich selbständig in die Unternehmensstrukturen zu integrieren. KMU sollen sensibilisiert werden, nachhaltige Aktivitäten zu identifizieren und nutzbringend abzubilden.